Synthetische Daten im Jahr 2026: Wie künstliche Datensätze Modelle trainieren, ohne Privatsphäre zu gefährden

Synthetische Daten haben sich von einem Nischenthema der Forschung zu einem praktischen Werkzeug entwickelt, das Teams nutzen, wenn sie Machine-Learning-Modelle bauen möchten, ohne reale Personendaten offenzulegen. Im Jahr 2026 ist das Interesse nicht nur technischer Natur: Organisationen wollen den Umgang mit personenbezogenen Daten reduzieren, das Teilen von Daten vereinfachen und die KI-Entwicklung im Einklang mit der DSGVO sowie dem Zeitplan des EU-KI-Gesetzes gestalten. Synthetische Daten können dabei helfen – aber nur, wenn sie mit derselben Sorgfalt erstellt, geprüft und gesteuert werden wie jeder andere Datenbestand.
Was synthetische Daten wirklich sind (und was nicht)
Synthetische Daten sind Datensätze, die von einem Algorithmus erzeugt werden, um die statistischen Muster eines ursprünglichen Datensatzes nachzubilden. Enthält die Quelle beispielsweise Patientendaten, Transaktionsprotokolle, Call-Center-Transkripte oder IoT-Signale, soll die synthetische Version auf aggregierter Ebene ähnlich aussehen und sich ähnlich verhalten. Das Ziel ist meist die Nutzbarkeit: Modelle, die mit synthetischen Daten trainiert werden, sollen in etwa so performen, als wären sie mit realen Daten trainiert worden – ohne reale Datensätze direkt offenzulegen.
Wichtig ist die Abgrenzung zu „Fake-Daten“, die manuell für Demos erstellt werden. Moderne synthetische Daten entstehen mit Verfahren wie Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoders (VAEs), Diffusionsmodellen oder spezialisierten Methoden für tabellarische Datensynthese. Diese Verfahren lernen Verteilungen aus Quelldaten und ziehen daraus neue Stichproben. Dadurch können synthetische Datensätze Korrelationen bewahren, die für Machine Learning entscheidend sind – etwa Zusammenhänge zwischen Symptomen und Diagnosen oder zwischen Ausgabeverhalten und Betrugsmustern.
Synthetische Daten sind zudem nicht automatisch anonym. Wenn der Generierungsprozess seltene Kombinationen reproduziert oder Ausreißer „auswendig lernt“, kann ein synthetischer Datensatz realen Personen zu ähnlich werden. Regulierungsbehörden und Privacy-Engineering-Teams behandeln synthetische Daten deshalb als Maßnahme zur Risikoreduktion – nicht als Schalter, der DSGVO-Pflichten einfach abschaltet. Die sicherste Haltung im Jahr 2026 lautet: Man sollte synthetische Daten als potenziell personenbezogen betrachten, solange nicht durch robuste Tests und Dokumentation das Gegenteil belegt ist.
Wo synthetische Daten zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung liegen
Aus Sicht des Datenschutzes liegen synthetische Daten irgendwo zwischen Anonymisierung und starker Pseudonymisierung. Pseudonymisierung entfernt direkte Identifikatoren, erhält aber eine Struktur, die sich oft noch verknüpfen lässt; Anonymisierung zielt darauf ab, Identifizierung nicht mehr mit vertretbarem Aufwand wahrscheinlich zu machen. Synthetische Daten können manchmal ein anonymisierungsähnliches Ergebnis erreichen – aber nur, wenn Prozess und veröffentlichter Datensatz Re-Identifikationsversuchen standhalten.
Im Vereinigten Königreich betont die Anonymisierungsleitlinie des ICO einen risikobasierten Ansatz: Man bewertet, was ein Angreifer realistisch tun könnte, welche Zusatzdaten verfügbar sein könnten und welcher Schaden entstehen würde. Dieses Denken passt gut zu synthetischen Daten, weil die Kernfrage nicht lautet „Wurden neue Zeilen erzeugt?“, sondern „Kann jemand immer noch eine Person herausgreifen, verknüpfen oder Informationen über sie ableiten?“
In der Praxis ordnen Teams synthetische Daten häufig in Stufen ein. Manche synthetischen Datensätze bleiben eingeschränkt und werden nur intern unter strenger Zugriffskontrolle genutzt, weil weiterhin ein Offenlegungsrisiko bestehen kann. Andere werden gezielt für das sichere Teilen mit Dienstleistern oder Forschungspartnern konstruiert – gestützt durch Tests, die eine geringe Wahrscheinlichkeit für Membership-Inference oder Attribute-Inference zeigen. Diese Staffelung hilft, Governance an der tatsächlichen Risikolage auszurichten statt am Etikett „synthetisch“.
Wie synthetische Daten die Privatsphäre beim Modelltraining schützen
Der Vorteil für den Datenschutz besteht darin, dass reale Datensätze weniger direkt exponiert werden. Statt Entwicklern oder externen Teams Zugriff auf Rohdaten von Kundinnen und Kunden zu geben, können Organisationen synthetische Datensätze bereitstellen, die die relevanten Muster für das Training bewahren. Das begrenzt internes Fehlverhalten, reduziert die Angriffsfläche und unterstützt Prinzipien der Datenminimierung, weil weniger Personen Zugang zu den Originaldaten benötigen.
Synthetische Daten erleichtern außerdem Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg und Tests in Sandboxes. In vielen Organisationen ist die langsamste Phase der Modellentwicklung die Genehmigung für den Zugriff auf sensible Daten. Wenn synthetische Daten verfügbar sind, können Teams früher mit Feature Engineering, Pipeline-Design und Evaluation beginnen. Danach wird nur noch eine kleinere, streng kontrollierte Phase mit realen Daten benötigt – etwa für finale Kalibrierung oder regulatorisch geforderte Validierung.
Im Jahr 2026 werden synthetische Daten häufig zusammen mit weiteren Privacy-Enhancing-Technologien eingesetzt, statt als alleinige Lösung. Ein verbreitetes Muster ist: synthetische Daten aus einem bereits gefilterten, aggregierten oder streng governeten Datensatz erzeugen; während Generierung oder Training Differential Privacy einsetzen; und Privacy-Audits nutzen, um messbar zu machen, was potenziell leaken könnte. Dieser mehrschichtige Ansatz spiegelt den regulatorischen Trend zu nachweisbarer Rechenschaftspflicht wider.
Die drei Leckagerisiken, die Sie adressieren müssen
Das erste Risiko ist Memorisation. Manche Generatoren können nahezu Duplikate seltener Zeilen aus den Trainingsdaten reproduzieren – besonders wenn der Datensatz klein ist oder extreme Ausreißer enthält. Deshalb reicht eine Prüfung „sieht realistisch aus“ nicht aus. Benötigt werden Ähnlichkeitsprüfungen gegenüber den Quelldaten sowie Regeln, um seltene Fälle zu entfernen oder zu glätten.
Das zweite Risiko ist Membership Inference: Ein Angreifer versucht festzustellen, ob der Datensatz einer bestimmten Person in den Trainingsdaten enthalten war. Selbst wenn synthetische Daten keine Datensätze kopieren, kann der Generator genug Information kodieren, um solche Tests zu ermöglichen. Das ist heikel, weil bereits die Mitgliedschaft sensible Fakten offenlegen kann – zum Beispiel, ob jemand in einem Krebsregisterdatensatz vorkam.
Das dritte Risiko ist Attribute Inference. Ein Angreifer kann private Attribute über eine Person ableiten, indem er synthetische Daten mit Zusatzinformationen verknüpft – insbesondere, wenn einzigartige Kombinationen erhalten bleiben. Praktische Gegenmaßnahmen sind die Quantifizierung des Offenlegungsrisikos mit etablierten Privacy-Metriken sowie Kontrollen wie Differential Privacy, k-Anonymity-ähnliche Einschränkungen, Unterdrückung seltener Kombinationen und sorgfältige Freigaberichtlinien.
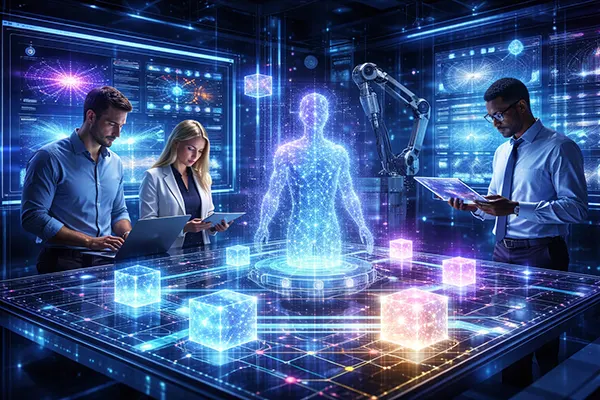
Wie „gute synthetische Daten“ 2026 aussehen: Nutzen, Risiko und Governance
Hochwertige synthetische Daten balancieren Nutzen und Privatsphäre. Nutzen bedeutet, dass der synthetische Datensatz die Beziehungen erhält, die für den Anwendungsfall entscheidend sind: Modellleistung, Feature-Verteilungen und Abdeckung relevanter Szenarien. Privatsphäre bedeutet, dass sich begründen lässt, warum die Nutzung oder Weitergabe des Datensatzes kein unangemessenes Risiko erzeugt, Personen zu identifizieren oder sensible Fakten über sie zu erfahren.
Im Jahr 2026 bewerten viele fortgeschrittene Teams synthetische Daten mit einer dreiteiligen Scorecard. Erstens statistische Treue: Ähnlichkeit von Verteilungen, Erhalt von Korrelationen und Abdeckung von Randfällen. Zweitens ML-Nutzen: Das vorgesehene Modell wird auf synthetischen Daten trainiert und die Leistung mit einem Baseline-Modell verglichen, das auf realen Daten trainiert wurde. Drittens Privacy-Risiko: Ähnlichkeit zu Quelldatensätzen, Membership-Inference-Tests und Attribute-Inference-Tests.
Governance ist der Teil, den viele Teams unterschätzen. Synthetische Daten sind ebenfalls ein Datenprodukt: Sie brauchen Versionierung, Lineage, Zugriffskontrollen, Dokumentation und Monitoring. Außerdem braucht es klare Regeln, wofür sie verwendet werden dürfen. Ein synthetischer Datensatz, der für Fraud-Modelling erstellt wurde, kann für Marketing-Segmentierung ungeeignet sein, wenn er demografische Muster verzerrt oder verstärkt. Synthetische Daten pauschal als „standardmäßig sicher“ zu behandeln, ist ein häufiger Auslöser für spätere Compliance- und Fairness-Probleme.
Regulatorischer Realitätscheck: DSGVO, EU-KI-Gesetz und Rechenschaftspflicht
Die DSGVO verlangt bereits, dass Organisationen eine rechtmäßige Verarbeitung, Datenminimierung und angemessene Sicherheitsmaßnahmen nachweisen, wenn personenbezogene Daten betroffen sind. Synthetische Daten können die Menge personenbezogener Daten in der täglichen Modellentwicklung reduzieren, entfernen Pflichten aber nicht automatisch – außer man kann belegen, dass der Datensatz unter einem realistischen Bedrohungsmodell effektiv anonymisiert ist.
Das EU-KI-Gesetz bringt zusätzliche Erwartungen an Risikomanagement, Dokumentation und Aufsicht für bestimmte Systeme mit sich – besonders für solche, die als hochriskant gelten. Selbst wenn synthetische Daten eingesetzt werden, müssen Organisationen unter Umständen dokumentieren, wie Trainingsdaten gewonnen, gesteuert und geprüft wurden und wie Risiken wie Bias und schädliche Ergebnisse gemindert wurden. Deshalb betrachten viele Compliance-Teams im Jahr 2026 synthetische Daten als einen Beleg innerhalb einer umfassenderen Governance-Akte – nicht als eigenständige Compliance-Strategie.
In der Praxis ist der am besten verteidigungsfähige Ansatz eine nachvollziehbare, prüfbare Spur: warum synthetische Daten gewählt wurden, welches Verfahren eingesetzt wurde, welche Privacy-Tests durchgeführt wurden, welche Grenzwerte gelten und wie der Datensatz über die Zeit überwacht wird. Das passt zur Richtung, die Regulierungsbehörden signalisieren: risikobasierte Kontrollen, klare Verantwortlichkeiten und Dokumentation, die interne Auditoren und – falls nötig – Aufsichtsbehörden prüfen können.
